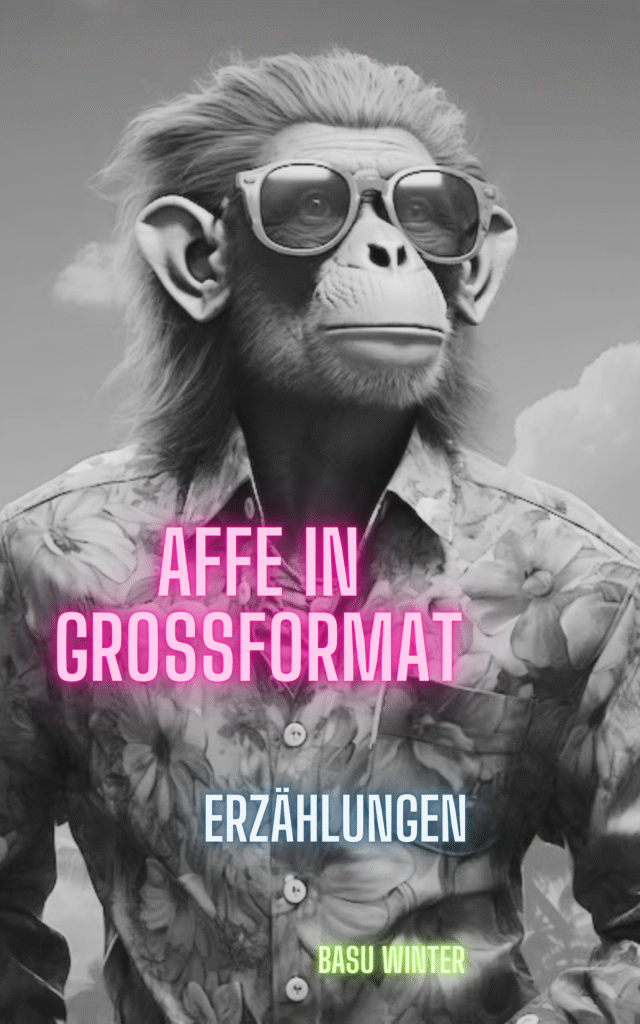
Affe in Großformat, Erzählungen
88 Seiten
Erzählungen der anderen Art — als schonungslose Abrechnung mit der Menschheit in der Gewissheit: Die Hölle sind wir.
Blick ins Buch
Der alte Kapokbaum
Der Schlossgartensee ist ein kleines Paradies. Zwei Libellen im Tiefflug über das glitzernde Wasser. Der Wind weiß nicht, wohin er will – Pollen fliegen kreuz und quer, Gräser wiegen sich mal hier-, mal dorthin, Staubwolken wirbeln empor und legen sich. Ein Blumenmeer taucht das Ufer in leuchtendes Gelb.
Inmitten der Blüten entspannt eine Entenfamilie – Gefiederpflege. Einige Weibchen machen sich auf den Weg ins Nass – eine Runde Paddeln durch den See. Weich und klar ist das Wasser, und irgendwie riecht es nach Erde. Frösche quaken aus dem Ufergestrüpp, unsichtbar wie die Vögel, die von den Bäumen am Steilhang gegenüber herabzwitschern. Manche Äste ragen bis ins Wasser. Weil der Wind mit den Blättern spielt, fluten immer wieder Lichtstrahlen in die Schatten, die die Bäume werfen. Wie, wenn man mit geschlossenen Lidern in die Sonne blickt. Genau so.
Tiefblau hangt der Himmel über den strahlend grünen Wipfeln. Von Wolken keine Spur. Sommerzeit, mitten im guatemaltekischen Winter. Castillo Cortez, dreißig Kilometer südlich von Antigua. Sara und David laden zur Hochzeit.
Für Karin war sie ein Alptraum, die Nachricht, dass die Hochzeit ihrer einzigen Tochter in Guatemala stattfinden würde. Sie hatte auf Bayern gehofft – auf jenes Hotel am Starnberger See, das Sara seit Kindesbeinen kennt – und mit England gerechnet, schließlich leben Sara und David dort. Aber Guatemala? Alles, was Karin wusste von diesem Land, war, dass es in Zentralamerika lag und man froh sein konnte, wenn man lebend wieder herauskam. Aber Sara war nicht abzubringen gewesen von ihrem Entschluss, und so galt es, die Zähne zusammenbeißen und durch.
Es waren grauenvolle Monate für Karin. Sie hatte zahlreiche schlaflose Nächte. Jeden Morgen las sie die aktuellen Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes im Internet. Sie las von hoher Gefahr von Entführungen. Von brutalen bewaffneten Raubüberfällen. Von tödlichen Anschlägen. Von Fällen von Lynchjustiz. Von gewaltbereiten Jugend- und Drogenbanden. Sie las von Malaria und Denguefieber und allerlei anderen lebensgefährlichen Infektionskrankheiten. Von unberechenbaren Wirbelstürmen. Von aktiven Vulkanen. Von verheerenden Erdbeben.
Auf die Internetrecherche folgten häufig Stunden am Telefon, im Auswärtigen Amt in Berlin kannte man sie schon, ebenso im Tropeninstitut in Düsseldorf, im Erdbebeninstitut der Universität Mannheim und im Gesundheitsamt München. Die Vorsorgeuntersuchungen und Impftermine bei Doktor Berger zogen sich über Monate, schließlich können die wenigsten Impfungen gleichzeitig erfolgen. Ernst, ihr Gatte, musste ständig Aufträge an Kollegen abgeben, weil er an manchen Tagen mehr Zeit in Doktor Bergers Wartezimmer verbrachte als im Ingenieurbüro.
Dann die Reiseapotheke – das Vertrauen in Herrn Fuchs, den Dorfapotheker, hatte Karin gänzlich verloren, nachdem sie zwei Bestellungen wieder zurückgeben musste, einmal hatte Herr Fuchs ein Malariamittel in der falschen Dosierung geliefert, was, wie ihr im Tropeninstitut versichert wurde, lebensbedrohliche Folgen haben kann, ein zweites Mal stimmte zwar die Dosierung, doch war das Haltbarkeitsdatum des Antibiotikums fast abgelaufen. So blieb Karin nichts anderes übrig, als die nötigen Pharmaka im sechzig Kilometer entfernten München zu besorgen, wo sie nach langer Recherche einen Apotheker ausfindig gemacht hatte, der zum Thema Reisemedizin promoviert hatte.
Vor allem aber sorgte sie sich um Joshua. Sie war regelrecht wütend auf Sara, sie fand es verantwortungslos von ihr, den Jungen solchen Gefahren auszusetzen. Davids Familie hätte doch herkommen können, Karin und Ernst hätten sogar die Flugtickets bezahlt. Verantwortungslos und egoistisch fand Karin es. Was sie auch nicht verhehlte, wenn sie mit ihrer Tochter telefonierte, weshalb Sara ihr zuletzt jegliche Anrufe verbat.
Und da sie nun endlich im Flugzeug sitzen, den Jungen zwischen sich, den Sara vor acht Tagen allein von London nach München hatte fliegen lassen – einen Neunjährigen! – und der Kapitän einen unruhigen Flug vorhersagt und angeschnallt sitzen zu bleiben bittet, könnte Karin auf der Stelle losheulen. Es ist, als fliege man zur Hochzeit seiner Tochter in die Hölle. Falls man überhaupt ankommt. Keine Mutter wünscht sich das.
Man mag lächeln über Karins Verhalten. Nur ist nichts lächerlich daran. Karin ist im Krieg geboren. Sie hat als Kind in der Hölle gelebt. Sie kennt die Tage in Angst und Hunger, die Nächte in Bunkern, sie hat die Schüsse und Schreie gehört, sie hat die Toten gesehen. Sie hat zusehen müssen, wie drei Russen ihre Mutter vergewaltigten, als Deutschland geschlagen war. Sie hat ihren Vater an den Krieg verloren. Sie hat ihre Kindheit an den Krieg verloren. Nie wieder Krieg. Nie wieder einen Mann mit einer Waffe sehen. Das ist immer Karins tiefster Lebenswunsch geblieben. Dafür hat sie immer zuallererst gebetet. Sie weiß, Sara findet, sie sei konservativ, sie habe Angst vor der Zukunft. Dabei hat sie doch bloß Angst vor der Vergangenheit. Dabei will sie doch bloß den Frieden festhalten. Und was zwanghaft ist an ihr, das Penible, das Perfektionistische, das sich nicht zuletzt in der Vorsorge für diese Reise niederschlug, es ist doch bloß der Ritus, der die Angst vergessen macht. Aufgrund dessen sie abends im Bett zu erschöpft war, um noch eine weitere Nacht schlaflos zu liegen. Früher mag man vor seiner Reise mit dem Dorfschamanen am Lagerfeuer gesessen haben, um die Schutzgottheiten zu Hilfe zu rufen. Heutzutage ruft man beim Leiter des Tropeninstitutes an und schluckt Tabletten zur Malariaprophylaxe. Oder man betet. Karin hat beides getan. Sie hat Gott und den Leiter des Tropeninstitutes angerufen. Und da sie nun im Flugzeug sitzt und auf der Stelle losheulen könnte, ist es ihr, als fliege sie zur Hochzeit ihrer Tochter in die Hölle ihrer Kindheit, und es ist nicht das Flugzeug, das wackelt, sondern der Bunker, der bebt unter fallenden Bomben. Und Karin sitzt da, in sich zusammengesunken, mit zitternden Händen, die Augen fest zusammengekniffen, derweil Ernst ihre Hand hält. Wie damals die Mutter. Karin ist wieder drei Jahre alt.
Sie mag sie noch so sehr verfluchen, die schreckliche Gnade dieses Augenblicks, die sie ihrer Tochter zu verdanken hat: Sie wirkt. Auch gegen Karins Willen. Das Leben will es endlich auflösen, das Trauma des Krieges, in einem persönlichen Frieden. Das Mädchen, das dem kollektiven Wahnsinn begegnete, es soll endlich zur Frau werden, die angstlos liebt. Es gibt kein Zurück ins kindliche Urvertrauen für einen Geist, der die Vergänglichkeit der Form, der den Wahnsinn der Welt, der den Abgrund im Menschen erfahren hat. Es gibt nur ein Vorwärts, hin zu dem, das in der Tiefe der Angst, das in der Tiefe der Hölle der Angst sich gänzlich verliert, um sich jenseits davon wiederzufinden.
Das ist die Stille, das ist der Friede, den Karin gerade erfährt. Und wo sie eben noch im endlosen Fall sich befand, wo sie eben noch verrückt zu werden glaubte, da ist es nun ganz still. Wo sie eben heulen wollte, weint sie nun. Wo die Angst Ernsts Hand erdrücken wollte, streicheln ihre Finger nun ganz sanft, ganz liebevoll die seinen.
Karin weiß nicht, wie ihr geschieht. Sie meint, es seien die Beruhigungstabletten, die endlich wirken. Und es ist ja auch dieselbe angstlose Stille. Nur ist es nicht dasselbe apathische Nichts, das der Stille erwächst. Darin, in dem, was ihre Hände geben aus der Stille, ohne dass Karin es merkt, in jener kleinen Geste der Liebe, besteht der einzige Unterschied zum intoxikierten Frieden.
Ernst, der nicht die geringste Ahnung hat, was gerade vor sich geht mit seiner Karin, der argwöhnisch verfolgt, was ihre Finger da treiben mit seiner Hand, der sich am liebsten in Luft auflösen würde in diesem Moment, in eine Wolke über dem Atlantik, da er einen hysterischen Anfall und ein Aufheben befürchtet ausgerechnet im Flugzeug – Ernst weiß nichts von einem Kriegstrauma, das sich nun, achtzig Jahre später, endlich erlösen will. In einem Alpendorf mit dreizehn Einwohnern aufgewachsen, hat Ernst vom Krieg nicht viel mitbekommen. Als Deutschland seine Trümmer in neue Häuser verwandelte, saß Ernst in der Dorfschule und paukte Mathe. Und als Ernst in den Sechzigern ins Arbeitsleben einstieg, war der Wiederaufbau in vollem Gange und Deutschland boomendes Exportland. So sehr Karin das Sinnbild des deutschen Kriegstraumas ist, so sehr ist Ernst das Sinnbild des deutschen Wirtschaftswunders. Als Nachbau in Miniaturformat. Ernst fing auch mit nichts an. Nichts als den Spielschulden seines Vaters, der alles verzockt hatte, den Hof eingeschlossen. Ernst absolvierte sein Studium der Ingenieurswissenschaften in Rekordzeit, heiratete Karin, eröffnete ein Ingenieurbüro, fing zu malochen an – und hat bis heute nicht wieder aufgehört.
Das Ergebnis, abgesehen vom Abtragen des väterlichen Trümmerbergs: ein großes Einfamilienhaus Marke Eigenbau mit fast 8000 Quadratmetern Grundstück; ein Bürohaus, in dem auch seine Firma sitzt mit mittlerweile zwanzig Angestellten; eine Eigentumswohnung in München, die eigentlich für Sara gedacht war; und zwei Grundstücke mit Baugenehmigung am Starnberger See. Alles abbezahlt.
Wenn er alles verkaufte, wäre Ernst Multimillionär. Tut er aber nicht, allein schon der Vermögenssteuer wegen. Ernst müsste schon lange nicht mehr arbeiten, die Schlacht ist längst gewonnen. Ernst malocht trotzdem weiter. Wo andere sich im Garten in die Sonne legen würden, Campari schlürfend. Denn Ernst ist das deutsche Wirtschaftswunder. Er hat die deutsche Kriegerseele, er ist gekommen, um zu kämpfen und auf dem Schlachtfeld zu sterben. Ernst ist ein Krieger der Arbeit.
Wenn er nicht selbstständig wäre, also zum Rentnerdasein gezwungen werden könnte, würde Ernst vermutlich den Garten zum Schlachtfeld deklarieren und mit Hacke und Spaten aufmarschieren und die besten Rosen des Landes züchten. Oder die neuen Nachbarn verklagen, weil ihr Hund seine Beete vollkackt. So aber bewahrt er sich die Würde.
Andere mögen eine heimliche Angst vor Arbeit haben. Ernst hat eine heimliche Angst vorm Urlaub. Vor den Wochen Gran Canaria, die er ihr „gehören“, wie Karin es nennt, die er nichts tun darf, kein Ausflugsprogramm erstellen, kein Gespräch mit dem Manager fordern über den angeblichen ‚Balkon mit Meeresblick’, keine Aufträge delegieren per Laptop, nichts. Natürlich arbeitet er trotzdem, heimlich, im Kopf, während er Karins Rücken eincremt mit Schutzfaktor zwölf oder Däumchen drehend daliegt am Strand unterm Sonnenschirm, dessen Gewinde längst ausgetauscht gehört, und Campari schlürft. Was am Meer so schön sein soll – Ernst weiß es nicht. Abends muss er sich schick anziehen zum Dinner draußen am Pool bei Rotwein und Kerzenlicht, ein stundenlanges Prozedere mit sechs Gängen, in aller Feierlichkeit. Vierzehn Abende lang. Er tut es Karin zuliebe. Für die Frau, die ihm den Rest des Jahres den Rücken freihält. Ihr zuliebe tut er, als sei auch ihm danach, nach dem Essen noch einmal zum Strand hinunter zu spazieren und sich im Mondlicht zu küssen.
Ernst kommt immer erschöpft zurück aus dem Urlaub. Es ist die Erschöpfung eines Mannes, der zwei Wochen lang gegen seine Natur zu leben gezwungen war. Es ist die Schlacht, die er verliert, weil er nicht kämpfen darf. Ein Krieger lebt für den Kampf, und er stirbt auf dem Schlachtfeld. Welchen Kampf er kämpft, das entscheidet das Leben. Die Zeit, die Welt, in die er geboren wird. Was wäre heute der Kampf, nach der Zeit des Krieges, des Wiederaufbaus, des Wirtschaftswunders? Was würde der kleine Ernst heute tun, was wird Joshua tun mit den Millionen seines Großvaters? Was wird das Leben von ihm wollen?
Ernst weiß es nicht. Er möchte nicht in der Haut seines Enkelsohnes stecken. Der Junge kennt seinen eigenen Vater nicht. Eine richtige Heimat hat er auch nicht, Sara und David arbeiten für einen multinationalen Großkonzern, die leben heute in London, morgen in Zürich und übermorgen in Toronto, ein Ort ist keine Heimat mehr. Auch keine Sprache. Getauft ist der Junge auch nicht, er kennt nicht einmal die Tischgebete. Er wirkt so verloren. Wie ein Krieger ohne Schlachtfeld. Wie ein Baum ohne Wurzeln, ohne Stamm.
„Nun lass den Mann mal wieder los.“
Ernst ist es nicht nur fremd, sondern auch peinlich, das herzliche Getue seiner Karin Davids Familie gegenüber. Innige Umarmungen werden die äußere Kluft nicht überbrücken, die immerhin 10.000 Kilometer umfasst und nicht weniger Jahre Kulturgeschichte, die unterschiedlicher kaum sein könnte. Und die paar Bücher über die Kultur der Mayas und die paar Brocken Spanisch, die Karin vorab gelesen und gelernt hat, werden langfristig nicht über die Tatsache hinwegtäuschen können, dass man sich im Grunde kaum etwas bis nichts zu sagen hat.
Ernst spürt, etwas ist anders an seiner Karin, bloß weiß er nicht, was. Er weiß bloß, er mag es nicht. Dabei hält Karin sich schon zurück. Im Innern ist sie vollkommen überwältigt. Die einstündige Fahrt vom Flughafen hierher, sie war nicht das, was sie für Ernst war, ein Höllenritt nämlich ohne erkennbare Verkehrsregeln, bei dem er sicherheitshalber die Türen und Fenster verschloss. Karin war dem, vor dem sie sich eigentlich hatte schützen wollen, schutzlos ausgeliefert: Sie schmeckte die bitteren Tränen der Armut, sie sah die vielen Kinder am Straßenrand, die barfuß in eine aussichtslose Zukunft liefen. Sie spürte auch etwas Bedrohliches, eine dunkle Wolke, die über diesem Land hing, so dunkel, dass es ihr kalt den Rücken runter lief. Doch sie sah auch die Sonne, das Glitzern in den lachenden Augen winkender Kinder, sie sah auch die Schönheit Guatemalas, die Schönheit, die möglich wäre.
Ernst sah den Krieg. Karin sah die Liebe ohne Frieden. Sie sah mit offenem Herzen, und es tat ihr so weh, ihre winterlichen Gallenkoliken waren nichts dagegen. Sie spürte die Kraft der mächtigen Vulkane ringsum, und zwar als Naturgewalten, die nicht nur die Erde erbeben lassen, sondern auch uns bis ins Innerste bewegen und erschüttern.
Ernst sah die Kluft. Karin blickte in den Abgrund. Und was sie dort sah, das darf nicht sehen, was als zivilisierte Welt funktionieren will. Es ist zu frei, viel zu frei. Und die Ansicht allein befreit uns zu unserer Ursprünglichkeit, zu unserer wahreren, zu unserer angstlosen Natur. Leben ohne Angst, Karin hätte nie für möglich gehalten, dass es das gibt. Aber jetzt weiß sie es. Jetzt weiß sie, was ihr nie gehört hat, was nie zu ihr gehört hat, was sie nicht ist. Jetzt hat sie endlich keine Angst mehr.
„Du führst dich auf wie eine Verrückte!“, brummt Ernst, der schon im Bett liegt, todmüde von der langen Reise, zur Balkontür hin, vor der Karin in ihrem Nachthemd steht und genüsslich an einer Zigarette zieht – ihrer ersten seit zweiunddreißig Jahren. „Was ist bloß los mit dir?“ Was soll Karin sagen? Es ist so schrecklich und schön, dass sie eine rauchen muss. Und sich die Wolldecke holen, um sich noch eine Weile