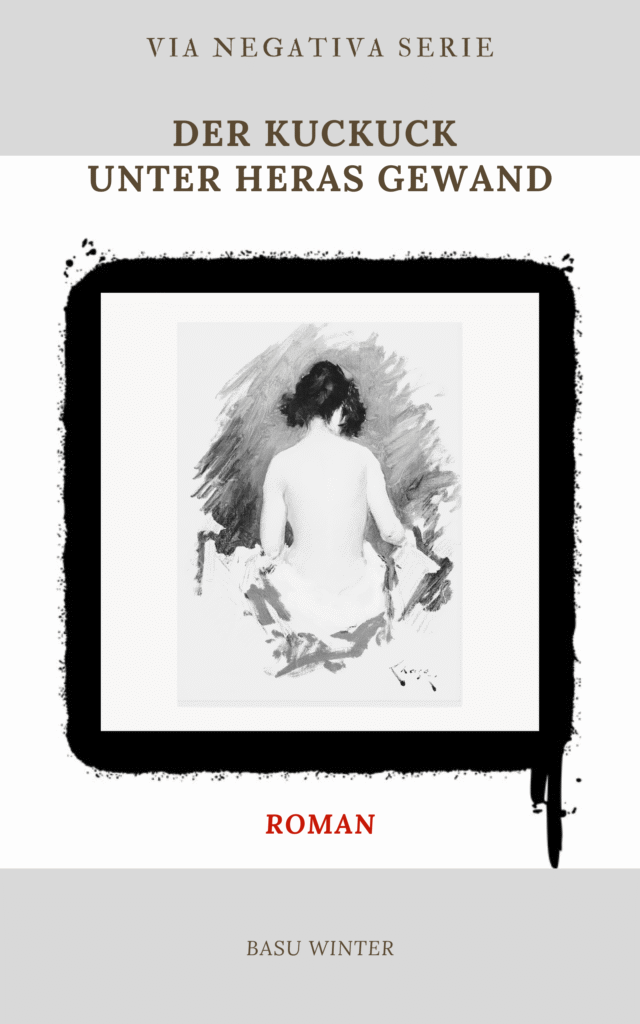
Der Kuckuck unter Heras Gewand, Roman
192 Seiten
Die archetypische Reise in Hermann Hesses ‘Narziss und Goldmund’ und Sören Kierkegaards ‘Endweder Oder’ verlegt Winter auf die Straßen Bangkoks. Und so nimmt der Wahnsinn seinen Lauf.
Blick ins Buch
Kürzlich nahmen sich innerhalb einer Woche zwei Ausländer hier in Bangkok das Leben. Ein Italiener erhängte sich an einer Autobrücke, ein Irländer sprang vom vierten Stock des Flughafengebäudes. Laut Medienberichten war beider Motiv finanzieller Ruin. Dabei laufen neun Zehntel der Weltbevölkerung mit leeren Taschen durch die Gegend, und manch einer trällert sogar sein Lieblingslied dabei. Allenfalls mag die Deutung des Geldmangels den Strick gezogen haben. Hab ich nichts, bin ich nichts, das alte Lied. Dafür spräche die europäische Herkunft. Möglicherweise war auch schiere Angst das auslösende Moment, da Geld mit Sicherheit verwechselt wurde, der Wahn, der sedierende Wahn der Habenden, und dann der Entzug, der Angst machte, die irgendwie kanalisiert werden musste. Er könnte auch östlich geprägt gewesen sein, der Abgang, stolz war der Krieger, der einst in die Schlacht zog, gegen wen, gegen was, wer weiß, sicher ist, er hat verloren, um der Ehre willen zahlt der Samurai nun mit dem Leben. Womöglich war Enttäuschung das auslösende Moment, Bitten um Hilfe, die ausgeschlagen wurden, sodass der Begriff Freundschaft sich gänzlich verlor und auf immer und ewig im All entschwand. Oder die Liebe, die große Liebe, so lange ersehnt, in Thailand endlich gefunden, plötzlich verpufft, als das Geld alle war. Oder das Phantom eines Gottes, von Kindheit an gepflegt, obschon, wenn alles glattlief, auf Eis gelegt, immerhin stets in Treue angebetet, wenn’s Probleme gab, ist plötzlich verpufft und Giovanni stand allein im Nichts. Es sei denn, die Geistestätowierung war zu tief imprägniert und das Phantom blieb und nur der Umgangston änderte sich: „Von wegen du sorgst für mich, du Arsch! Vaffanculo! Dir zeig ich’s!“
Oder aber es war viel mehr Leichtigkeit im Spiel, eine spontane Laune aus dem Bauch heraus, auch für Jimmy selbst überraschend, ein Sprung ganz ohne Drama, einfach so, gleich nach dem Einchecken, aus purer Freude an der Freiheit des Menschenwillens. Oder eine gänzlich unspontane, eine altbekannte Laune, die Schwermut der Wahrhaftigkeit, forderte ihr Recht, ein feiner Geist war es, der es zu Ende gedacht hatte, das Leben, und für sinnlos befunden, bevor das Auge des Weisen ihn fand, noch eh er ihn tat, den rettenden Blick jenseits der Form, die vergeht. Oder ein Ruf aus dem Jenseits könnte erschallt sein, eine geliebte Seele, die Hilfe braucht, oder die Stimme der Heiligkeit, die verkündete, der Lehrplan sei erfüllt, die Zeit zum Aufbruch endlich gekommen.
Was auch immer – leere Taschen jedenfalls sind kein Motiv, sondern leere Taschen. Klar, ist man volle Taschen gewohnt, ist es zunächst einmal ein Schock, wenn die Hand plötzlich ins Leere greift. Aber bloß aus Gewohnheit, nicht aus Notwendigkeit. Gewohnheit macht den Geist klein, und nur ein gewohnheitsmäßig verkleinerter Geist kann überhaupt schockiert werden.
Jerome zum Beispiel ist ein lebendiger Beweis dieser These. Jerome lebt auf der Straße, in Designerklamotten, mitten in Bangkok. Dabei bewohnte er noch vor einem halben Jahr ein Penthouse im kalifornischen Malibu Beach, gleich an der Strandpromenade – und jetzt schläft er in Korbstühlen von irgendwelchen Bangkoker Straßencafés. Aber erst gegen Morgen, da er ansonsten Gefahr läuft, von patrouillierenden Polizisten in Gewahrsam genommen zu werden, was, wie Jerome bereits erfahren musste, in einem Polizeistaat wie Thailand nicht selten in brutalen Erniedrigungen hinter verschlossenen Türen mündet, wenn das Geld fehlt, um sich Schonung zu erkaufen. Land des Lächelns, weil es die Grausamkeit in seine Gefängnisse verlegt. Wer hier landet, in des Saubermannes Schattental, in Thailands Land der Tränen, dessen Name wird geschändet, dessen Würde wird getötet, dessen Welt wird nie mehr sein, was sie auch immer war.
Und deshalb schläft Jerome nicht im Park auf der Wiese, sondern in Korbstühlen, aber nur, wenn keine betrunkene Touristin willig ist, ihn mit ins Bett zu nehmen – was ab und an der Fall ist, denn Jerome ist ein Frauentyp, witzig, charmant, attraktiv, sein Gesicht, wie soll ich es beschreiben, wie kommt es, dass ich jedes Mal die Sprache verliere, wenn es darum geht, Gesichter zu beschreiben, und noch nie mir ein Gesicht habe vorstellen können, das ich nicht mit eigenen Augen gesehen habe, sondern nur aus Worten kenne, sogar Dostojewskis Gruschenka blieb gesichtslos in meiner Phantasie, bis Maria Schell sie schließlich erlöste, Jerome ist Will Smith nicht unähnlich, sagen wir in Anbetracht meiner Unfähigkeit, Gesichter in Sprache zu übersetzen und Sprache in Gesichter, es gibt ganz sicher einen Namen für diese Störung, am Hirn wird es liegen, Will Smith in Karibisch und weniger glatt, denn wenn Jerome die Sonnenbrille abnimmt, dann blickt man in Augen, die älter sind als seine siebenundvierzig Lebensjahre, dann blickt man in die Tiefe der Zeit, und manch eine Touristin erschrickt davor. Wieso schreibt der Kerl dann, mit solch einer Hirnstörung, wird manch einer fragen, vor allem, wenn er Will Smith nicht kennt. Jean-Paul Belmondo? Der in schwarz mit Rastalocken.
Seit drei Monaten schon jedenfalls lebt Jerome so, auf der Straße, meine ich, ohne eine Spur von Panik oder Kummer. Ab und an taucht plötzlich wieder Geld auf, keine Ahnung woher, das dann, unabhängig von der Höhe der Summe, in ein bis zwei Tagen verpulvert wird – gebrauchte Bücher, die er nie lesen wird, in allen möglichen Sprachen, hier ein silbernes Armband, das er bis zum nächsten Morgen verschenkt oder verloren haben wird, dort ein neues Hemd, eine Rasur beim Barbier, ein Abend bei Bier und Livemusik in großer Runde – auch fünfhundert Dollar sind schnell weg, wenn man nicht spart. Und Jerome spart nichts – und wählt auch nichts. Es gibt niemanden, mit dem er nicht plaudern und ein Bier oder zwanzig trinken würde, und irgendjemand findet sich immer, und immer ist es jemand anderes. Es gibt keinen Menschen, den er nicht ansprechen würde zu diesem Zwecke, wenn er, was selten und allenfalls kurzzeitig der Fall ist, allein am Straßenrand sitzt. Es gibt auch keine Frau, die er nicht vögeln, keinen Lady Boy, von dem er sich nicht einen blasen lassen würde. Im Gespräch ist auch nichts von einer kontrollierenden, irgendeine Art von Ordnung schaffenden Instanz zu spüren, er kommt in Nullkommanichts vom Hölzchen aufs Stöckchen („… Morrison, Marley, Hendrix, they all died young, man! …. Man, the only time I went to a Buddhist temple, I cried for three hours!“), um im nächsten Moment wieder zusammenhangslose Monologe vor sich hin zu nuscheln oder skandinavischen Schönheiten hinterherzurufen („Excuse me, are you Siamese?“) oder einem deutschen Ehepaar („Excuse me, what am I doing here?“), das mit strengem Blicke richtet, was und was sich nicht gehört,– nur ab und an, wenn er plötzlich in Schweigen verfällt, aus dem heraus ein anderer, ein langsamerer Strom entsteht („We are all one. Each one of us is all. But everyone wants to be one. Not all. Just one. You know?“), dann erahnt man, das da vielleicht doch so etwas existiert wie ein Auge des Sturmes, des Tornados stille weise Mitte. Aber nur ganz kurz, denn auch hierbei bleibt es nicht, alles ist möglich im nächsten Moment und alles willkommen („Excuse me, Lady, do you go, where I go?“).
Giovanni jedenfalls hätte einiges lernen können von Jerome in Sachen Lebenskunst – und auch Mehmet, ‚Turkey‘, wie wir ihn nennen, zumal wir alle sie nicht mehr hören können, seine Lebensgeschichte, mit Leidensmiene erzählt, in zwei Dönermaschinen mündend, vom Verkauf seines geliebten Bootes in Antalya finanziert, eigens per Bus nach Thailand verfrachtet, per Bussen vielmehr, vom Mittelmeer aus über den Iran, Pakistan und Indien bis hierher, ins Land der verborgenen Tränen – und auf Ko Samui schließlich von seinem besten Freund geklaut. Eine ganz alltägliche Geschichte also, aber Turkey ist es offenbar gewohnt, Freunde zu haben, und zutiefst schockiert („My friend, you know …“). Darüber hinaus hat er zweifellos das Rechnen vergessen, denn die siebzig Dollar, die er noch übrighat, reichen keinesfalls für die Rückreise in die Türkei, wo er ein geerbtes Grundstück verkaufen und neue Dönermaschinen kaufen will. Auch nicht per Bus, zumal allein die nötigen Visa über die Hälfte des Geldes vertilgen. Seine Familie hat allem Anschein nach kein Geld, und das Gesuch in der türkischen Botschaft vor zwei Tagen, bei dem er über seine Leidensgeschichte hinaus sogar einen Polizeibericht über den Diebstahl vorlegte, hat nichts als Verlust eingebracht, nicht nur materiell aufgrund der Kosten der Busfahrt zur Botschaft, immerhin achtzig Cent hin und zurück, sondern auch in jenem Teil der Geisteswelt, der schockiert werden kann – sein Patriotismus hat einen erheblichen Dämpfer erlitten, um nicht zu sagen, ist auf Nimmerwiedersehen davongesegelt ins All: „Go fuck off, they said!“
Turkey ist fest entschlossen, seine Staatsbürgerschaft abzugeben und auszuwandern: „Fuck Turkey, man!“
Ich reiche Turkey ein paar Scheine und teile den Rest, den ich noch in meinen Hosentaschen finde, zwischen Jerome und dem Bettler am Straßenrand auf, dessen Plastikbecher immer leer ist, weil er kein verkrüppeltes Bein hat. Mit Mitleid hat es nichts zu tun, ich sage es immer wieder, im Gegenteil. Wenn der alte Thai lacht, dann leuchten seine Augen, dann sehe ich den weisen Narren, der ohne Hoffnung glücklich ist. Das Leuchten ist natürlich tief unter allerlei Dreck und Gestank verborgen, insofern verstehe ich, dass ein Giovanni es nicht sieht. Ich habe es ja lange selber nicht gesehen. 2012 zum Beispiel habe ich meine sieben Sachen gepackt und auf den Untergang der Welt gewartet. Als Covid kam, hörte ich die Glocken abermals läuten und dachte, dass Ende der Menschheit sei gekommen. Ich bin Nihilist und war damals noch grundsätzlich pessimistisch und im Übrigen keineswegs abgeneigt, selber von der Brücke zu springen.
Aber dann habe ich plötzlich angefangen, Kreise zu sehen, wo vorher Linien waren. Und da siehst du kein Ende mehr. Sprich, die Hoffnung, die mit dem Sprung verbunden ist, löst sich quasi in Luft auf. Oder besser gesagt, sie verlagert sich wieder zurück ins Hier und Jetzt, in diese Welt. Und die Hoffnungslosigkeit hier und jetzt, die ist der Segen. Giovanni hätte das Nichts, in das er zu springen meinte, hier suchen müssen. Die Hindus denken ja auch in Kreisen. Die sprechen von unserem Zeitalter als dem dunkelsten, dem Kail Yuga, sehen es aber als Teil eines größeren Zyklus, dem noch ganz andere Zeitalter angehören, die längst nicht so düster sind. So sehe ich es eben auch. Nur, dass bei mir all das Theater um Zyklen und Kreise ums Nichts kreist.
Hier im Kali Yoga geht’s ja im Groben darum, sich die Erde – und einander – Untertan zu machen. Also quasi in Gottes Namen Krieg gegen das Göttliche zu führen. Und da sind die Götter mit im Geschäft. Man muss ja nur den ersten Gesang in Homers Ilias lesen, da weiß man schon, was Sache ist: „Den Priester Chryses zu rächen, dem Agamemnon die Tochter vorenthielt, sendet Apollon den Achaiern eine Pest. Agamemnon zankt mit Achilleus, weil er durch Kalchas die Befreiung der Chryseïs fordern ließ, und nimmt ihm sein Ehrengeschenk, des Brises Tochter. Dem zürnenden Achilleus verspricht Thetis Hilfe. Entsendung der Chryseïs, und Versöhnung Apollons. Der Thetis gewährt Zeus so lange Sieg für die Troer, bis ihr Sohn Genugtuung erhalte. Unwille der Here gegen Zeus. Hephaistos besänftigt beide.
Singe den Zorn, o Göttin, des Peleiaden Achilleus, Ihn, der entbrannt den Achaiern unnennbaren Jammer erregte, Und viel tapfere Seelen der Heldensöhne zum Aïs sendete, aber sie selbst zum Raub darstellte den Hunden, und dem Gevögel umher. So ward Zeus Wille vollendet: Seit dem Tag, als erst durch bitteren Zank sich entzweiten Atreus Sohn, der Herrscher des Volks, und der edle Achilleus. Wer hat jene der Götter empört zu feindlichem Hader? Letos Sohn und des Zeus. Denn der, dem Könige zürnend, sandte verderbliche Seuche durchs Heer; und es sanken die Völker.“
Das steht natürlich so nicht in den Zeitungen, da ist immer nur von Klimaschutz und Demokratie und neuen Friedensverhandlungen die Rede. Dabei ist es in Wirklichkeit die ganze Zeit lang einfach weiter gegangen mit Homers Ilias. Man müsste ja nur die Namen im Text mit solchen ersetzen, die heute in den Nachrichten auftauchen, dann merkte man’s. Tut aber keiner. Zumal keiner mehr durchblickt, wer denn nun die verderbliche Seuche sandte, wie die Völker denn letztlich sinken und was eine tapfere Seele überhaupt ist. Die Täuschung ist eben die mächtigste Waffe in diesem Krieg. Sie ist sogar so mächtig, dass die Hindus eine Gottheit nach ihr benannt haben: Maya. Mich interessiert das Kali Yuga eigentlich nur noch am Rande. Wahrscheinlich hat es mich auch nie wirklich interessiert, sondern lediglich aus Eigeninteresse beschäftigt. Allenfalls vom Ende her interessiert’s mich noch. Klar, wenn die Völker allesamt sinken, dann ist’s sowieso vorbei, dann überleben ein paar Tröten in Platos Höhle und es geht wieder bei Adam und Eva los. Mich interessiert, wie der Übergang ohne die große Apokalypse vor sich gehen würde. Da müsste Homer Maya ins Spiel bringen, meine ich: Und die Völker erhoben sich. Hinauf zum Throne starrten sie. Leise, auf dass ihre Götter sie nicht hörten, sprachen sie direkt zur großen Mutter.
„Nicht die Götter haben uns zu Dir gesandt, oh große Mutter. Wir sprechen nicht in ihrem Namen, wie flehen nicht um ihrer Reiche willen. Ihr bitterer Zank geht uns nichts an. Und doch sinken wir, wo sie sich erzürnen, und warten vergebens, dass sie uns erheben. Darum flehen wir, lüfte den Schleier, oh Göttin der Täuschung, denn wir haben genug! Unser Jammer ist groß, unsere Freude verleidet. Wir können nicht mehr. Lüfte den Schleier, oh Göttin der Täuschung, wenn nicht für die Götter, dann wenigstens für uns! Wir flehen Dich an, geliebte Mutter, lass uns frei!“
„Ihr wolltet den Schleier“, erwidert die Mutter und lacht frei heraus, „genau wie die Götter ihn wollten. Nun wollt ihr, dass ich den Schleier lüfte? Ich kann ihn nicht lüften, ich will ihn nicht lüften, ich widerrufe nicht, was ich Euch geschenkt. Ihr sprecht, als sei das Geschenk eine Last und ein Fluch! Wie könnt Ihr es wagen? Hat Euch Kinder niemand Dankbarkeit gelehrt?“
„Zürne uns nicht, geliebte Mutter“, flüsterten die Völker reumütig und knieten nieder. „Versteh uns doch! Hilf uns doch, dem Jammer zu fliehen!“
„Ihr müsst den Schleier selber lüften! Es war nie ein Geheimnis, es gibt kein Geheimnis, ich sagte es doch, als das Geschenk ich Euch gab. Habt Ihr alles vergessen?“
„Wir wissen es nicht mehr!“, riefen die Völker und erhoben sich abermals. „Wie werden wir frei?“
„Aus euch selbst heraus gebärt ihr das Wie. Aus Eurem Willen heraus, es zu gebären. Euer Wunsch ist seine Saat. Und die Saat geht auf in Eurer Mitte.“
Wo soll die Saat denn aufgehen, in irgendeinem Großraumbüro, per programmierter App? In den Entsorgten, in den Verrückten muss sie aufgehen. In denen, die den Göttern und Menschen nichts mehr nützen. Denn was an der Kette der Zeit liegt und der linearen Welt dient, das kann sich als Kreis nicht schließen. Und genau deshalb gebe ich dem alten thailändischen Bettler jeden Tag ein wenig Geld.
So ist es. Merkwürdig. Wie das Bild, in dem ich stehe oder vielmehr sitze, hier auf der Bordsteinkante der Straße des Königs, mit der Bierflasche in der Hand, hier auf dem Planeten Erde, hier in der Hölle, hier im Himmel. Jerome macht sich gleich auf mit seinem Anteil, um Whiskey zu kaufen, derweil ich Mayuree und ihren neuen Begleiter beobachte gegenüber im Sushiladen. Einst waren wir ein Liebespaar, und heute grüßt sie mich nicht mehr. Und da mein Blick die Hand verfolgt, die unterm Tisch über jenes Bein streicht, das nachts im Schlaf so häufig auf mir lag, weiß ich, dass sie nichtsdestotrotz willkommen sein wird, wenn sie irgendwann wieder vor meiner Türe steht, wie schon einmal, als sie, obwohl sie längst in ein neues Liebesnest gesprungen war, plötzlich dastand nachts um vier, ohne Geldforderungen, aber mit großem Tamtam und einer fulminanten Koksallergie, Hautausschlag überall und geschwollenem und nässendem Nasenrachenraum, Gott sei Dank war der Kehlkopf nicht betroffen. Drei Tage lang lag sie in meinem Bett, durch kastaniengroße Wattebäusche in beiden Nasenlöchern, die ich regelmäßig zu entsorgen und den Nasengängen entsprechend neu zu formen hatte, gegen jede sexuelle Annäherung vonseiten ihrer Krankenschwester gewappnet. Sie wird willkommen sein, obwohl, nein, weil sie einen anderen vögelt. Merkwürdig, aber so ist es. Ich möchte verraten, verleugnet, ich möchte verlacht sein. Ich möchte unerkannt, ich möchte unverstanden sein.
Nicht etwa, weil ich irgendeinen seelischen Schaden hätte, aufgrund dessen ich in irgendeinem Teufelskreis toxischer Beziehungsmuster gefangen wäre. Ich lebe ja auch nicht mit einem halben Bein auf der Straße, weil ich kein Geld habe, obwohl man das meinen könnte und ich auch jeden in dem Glauben lasse. Klar, Hobbypsychologen würden einen Kontext finden, aus dem heraus es geradezu krankhaft aussehen würde, wie ich mich behandeln lasse. Ich weiß auch, welchen. Sturmklingeln im Morgengrauen, Wortfetzen, die ich im Halbschlaf aufnehme: „Starkregen……Schrecklicher Unfall………tot.“
Worte, die erst wieder aus dem Vergessen auftauchen, als ich mich Stunden später an den Frühstückstisch setze und in das versteinerte Gesicht meines Vaters blicke. Ähnlich nebulös ist die Erinnerung an die nächsten Tage und Monate, ein paar Bilderfetzen von der Beerdigung, von Schulferien im Bett mit hohem Fieber, von einem neuen Raum in mir, der sich langsam auftut, in dem ich mich in den Schlaf weine, ein Raum, in dem die Mutter fehlt. Stark hingegen ist die Erinnerung an das Leben, das ich heimlich zu leben beginne in diesem neuen Raum in mir, an meine heimlichen Recherchen zum Unfallort, den ich vielleicht nur deshalb unbedingt sehen will, weil ich es auf keinen Fall darf, an die Dringlichkeit, mit der mein Herz pocht, da ich langsam die Straßen abfahre in beide Richtungen, überall im Umkreis, an die Schärfe der Aufmerksamkeit, mit der meine Augen den Straßenrand nach Spuren eines Unfalls absuchen selbst dann, wenn ich kaum etwas sehe, weil es schon fast dunkel ist.
Fündig werde ich schließlich im Haus der Tante: ein ausgeschnittener Zeitungartikel, ein schwarz-weißes Foto, ich erkenne Mamas neuen Wagen sofort. Und ich kenne auch den Werbacher Ring, ich bin ihn schon entlanggefahren, nur an den Baum auf dem Foto, an den kann ich mich nicht erinnern.
Jeden Mittag nach der Schule fahre ich den großen Umweg, werfe mein Rad ins Gebüsch und setze mich unter die alte Eiche. Besser gesagt, ich arbeite. In der Hocke, sonst sehe ich die Glassplitter gar nicht, so winzig sind sie. Größere finde ich kaum noch, selbst dann nicht, wenn ich den Finger so tief in die Erde bohre, dass die ganze Hand darin verschwindet. Die größeren Splitter liegen alle schon feingesäubert auf dem Haufen, aus dem sich Mama nicht wieder zusammensetzen wird, das weiß ich. Ich weiß, dass meine Arbeit nutzlos ist. Aber sie will getan sein. Und ich will hier sein. Nicht etwa, weil ich hier bei Mama wäre. Sondern, weil ich hier den passenden Ort zu dem neuen Raum in mir gefunden habe – weil ich hier allein sein kann.
Wenn ich mich von der Hobbypsychologie hin zu einem tieferen Verständnis der Psyche des Menschen bewegt hätte, würde ich nach meinem Vater fragen. Warum er meint, dass ich den Unfallort nicht sehen darf, zum Beispiel. Warum er nicht weint auf der Beerdigung, warum er überhaupt nie weint. Warum er noch strenger wird nach Mamas Tod. Warum er mich nie in den Arm nimmt.
Und wenn ich über die Psyche hinaus noch die Seele im Blick hätte und das ganze Bild zu sehen suchte, dann würde ich nach Ker, der Göttin des Schicksals, fragen. Und klar erkennen, wie sie es fügt, dass meine Mutter sich doch wieder zusammensetzt aus den Splittern und aufersteht aus ihrem Grab.
Es ist ein ganz normaler Abend ein paar Wochen nach ihrer Beerdigung, ich sitze nach dem Abendbrot neben meinem Vater im Wohnzimmer auf der Couch, er trinkt wie üblich seine Flasche Bier. Es läuft der Film ‚Die Blechtrommel‘. Mamas Tod ist der erste große Riss durch meine Welt. Der kleine Oskar aber initiiert den ersten großen Riss durch mich selbst. Den ersten irreparablen Riss. Ich begreife überhaupt nichts an dem Film, einzelne Sequenzen setzen sich nicht zu einem roten Faden zusammen, sie addieren sich nicht zu einer Geschichte in meinem Kopf, alles bleibt ein wirres Chaos umherfliegender Bilderfetzen. Strand, Meer, Aale im Pferdekopf. Oskars Brausepulver in Marias Hand, in ihrem Bauchnabel, seine Verwegenheit, sein Speichel, den sie mit aufleckt. Oskar im Kleiderschrank, die Mutter auf dem Bett mit ihrem Liebhaber, dessen Hand unter ihrem Rock, ihr verwegenes Stöhnen zu seinem Finger in ihr. Oskars Schreien, bis Uhrengläser und Glühbirnen und Fensterscheiben zerspringen. Die rot-weiße Blechtrommel. Die Mutter, die plötzlich nur noch Fisch in sich hineinstopft, bis sie stirbt. Die Beerdigung des Vaters, die rot-weiße Trommel, die Oskar mit ins Grab wirft, sein Beschluss, wieder zu wachsen.
Als der Abspann läuft und ich meinen Vater mit Fragen zum Film überhäufe, winkt der nur ab. „Oben im Regal steht das Buch. Ich hab‘s nicht gelesen. Aber Grass war der Lieblingsautor deiner Mutter.”
Ich verschlinge das Buch noch in derselben Nacht. Der rote Faden wird sichtbar: Der Vater heiratet Maria, doch Oskar glaubt, es sei sein Sohn, den sie gebiert. Vielleicht darum tötet er den Vater. Aber die Mutter. War es Oskars Schuld? War es ein Unfall? Oder wollte Mama sterben?
Vater kann ich nicht fragen. Ich kann niemanden fragen. Nicht einmal mich selbst. Mein Herz beschützt mich davor. Die Kinderseele ist wie die Tierseele, da ist eine Reinheit, an die das Leben nicht heranreicht. Es waren zwar Ralf und Rolf, die beiden Hunde von Amon Göth, die etliche Häftlinge zu Tode bissen – aber es war Göth, dessen Seele dadurch schwarz wurde. Die Tierseele bleibt rein ein Leben lang. Die Menschenseele nicht. Die wachsende Bewusstheit trägt die Seele aus der sprach- und unbewussten Stille ihrer reinen Ursprünglichkeit langsam hinaus in ihre eigene Eigentlichkeit, in ihr Werden als eigener Name, als eigenes Wort, als singulärer Klang in der ewigen Stille.
Die Aufseherin, die auf Befehl des Lagerkommandanten Häftlinge quält, wird dumpf und dunkel von der Klangfarbe her und schwarz in der Seele, genau wie Göth – Ralf und Rolf aber nicht. Sie tragen nicht die Verantwortung, wo sie Befehlen gehorchen, sie können ja nicht außerhalb der Reinheit ihrer selbst treten. So wenig wie ich, der ich noch gar nicht anfangen kann zu wissen, warum Mama sich das Leben genommen hat, warum ich plötzlich nicht mehr zu der alten Eiche fahre, warum ich von toten Aalen träume, die in meinem Schädel leben, warum ich meine Frühstückssemmel heimlich an die Hunde verteile, warum ich nicht mehr wachsen will.
Das ist ja das Niederträchtige, ja Schwarze an der Geschichte um Oskar und seine rot-weiße Blechtrommel – dass sie Bewusstheit, die längst reif ist zur Schuld und sich auch schuldig macht auf tausende Arten und Weisen, als Kind verkleidet.
Ich lese das Buch nicht einmal, sondern zehnmal. Um der Klarheit wegen, die ich mir davon erhoffe. Bloß ist das Verwirrspiel viel zu tief, als dass ich es durchschauen könnte. Grass ist ein Hacker im Betriebssystem, Oskars Trommeln die hypnotische Induktion in ein vermeintliches Wunderland, das sich als dunkelster Albtraum entpuppt – aus dem ich nicht mehr herausfinde. Ein technischer Eingriff ist es, der bis in mein kindliches neuronales Netz vordringt und dort eine Störung verursacht, die, da sie unkorrigiert bleibt, das Ganze unterminiert.
Ich bin von dem Virus, den ich nun im System habe, vorerst lahmgelegt. Vielleicht war ich auch längst angesteckt. „Grass war Mamas Lieblingsautor.“ Ihr eigenes System muss tief gestört, ihr Herz muss irre gewesen sein, sie muss ihm gefolgt sein in ihren eigenen Untergang. Es muss dunkel gewesen sein in ihr, schwarz. Mama, die beim Anblick der Aale im Pferdekopf davonrennt und erbricht. Mama mit der Hand von Grass unterm Rock. Mama mit seinen dreckigen Fingern in ihr. Mama, die plötzlich nur noch Aale frisst. Die Aale in ihrem aufgebrochenen Schädel. Im Wrack des neuen Autos unter dem alten Baum.
Und wenn ich über alle Psychologie hinaus bis ans Ende der Welt gereist und dort aus ihr herausgefallen und schließlich wieder an ihrem Anfang angekommen wäre, dann würde ich gar nicht mehr von der Seite des Fluches auf die Dinge schauen, sondern von der Gnade her, die zu jedem Fluch gehört.
Für die Leute ist diese Sichtweise völlig verrückt. Für die Leute gibt es eine Grenze, und die ist auch ziemlich genau markiert. Und was sich jenseits der Grenze befindet – die toten Aale, die aufgebrochenen Schädel, die tödlichen Unfälle, die Selbstmorde, die Konzentrationslager – das ist der Fluch. Und das ist auch nicht verhandelbar. Die Begriffe würden ja völlig bedeutungslos, wenn es verhandelbar wäre und der Fluch plötzlich auf der Seite des Segens auftauchte oder umgekehrt.
Bei uns Verrückten geschieht aber genau das. Für uns ist die Hölle keine Dimension des Ganzen, sondern bloß ein Raum im Verstand des Menschen. Und nicht einmal dieser Raum ist unserer Sicht der Dinge nach verflucht oder gar ewig verflucht, er ist auch ein Segen. Wir Verrückte sehen ja gar keine Grenzen. Nicht einmal die offensichtlichste aller Unterscheidungen, die zwischen Dunkelheit und Licht nämlich, hat bei uns noch Bestand. Wenn man darüber nachdenkt, macht die Unterscheidung eigentlich auch gar keinen Sinn, schließlich ist es selbst in der dunkelsten Stunde der Nacht nie ganz schwarz, es ist bloß der Übergang von astronomischer zu morgendlicher Dämmerung. Uns Verrückte zieht die dunkelste Stunde magisch an. Und zwar deshalb, weil hier erst sichtbar wird, dass nicht nur die Sterne und der Tierkreis, sondern selbst die Moleküle in der Atmosphäre leuchten.
Und so interessiert mich die fremde Hand auf Mayurees nacktem Bein drüben im Sushiladen und mein bisschen Herzschmerz dazu wirklich nur am Rande. Ich bin anderswo, ich bin in das Buch in meiner Hand und in die Notizen vor mir auf dem Tisch vertieft, ich bin bei Kafkas Milena im Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück. Bei ihrem Sterben dort auf der Krankenstation nach Jahren in der dunkelsten Millisekunde der dunkelsten Stunde der Nacht. Dort im Stacheldraht hänge ich fest, nicht an der Hand auf Mayurees Bein. „Was mich hier am allermeisten erschreckt“, sagt Corrie ten Boom, eine Überlebende, „das sind die grauenerregenden Geräusche, die man hört: das Schreien der Geschlagenen, das Geräusch der schwingenden Riemen, das Kreischen und heisere Schreien und Schnauzen der bösen Menschen. Alles das macht Ravensbrück zur Hölle.“
Nicht in meiner kleinen Welt, in der ich lechze nach Verrat, bin ich, sondern bei Margarete Buber-Neumann, die ebenfalls überlebt, die darüber schreibt, wie es ist, „wenn aber die täglichen Qualen der Gefangenschaft auch noch die ständige Angst vor dem Tode einschließen – dann erleidet der Häftling einen so tiefgehenden Schock, dass seine Reaktionen nicht mehr als normal bezeichnet werden können. die einen werden hemmungslos aggressiv, um ihr Leben zu verteidigen, die anderen kriecherisch und zu jedem Verrat geneigt, und wieder andere resignieren in dumpfer Verzweiflung, in der sie sich weder gegen Krankheit noch Tod zur Wehr setzen”, die erzählt von dem „militärischen Drill, sie hatten keine Minute des Tages und der Nacht für sich allein, alle Verrichtungen geschahen in Gesellschaft von Hunderten von anderen, bei jedem Schritt, mit jedem Wort stießen sie gegen ein anderes unbekanntes, ebenso leidendes Geschöpf”, und von den „Totgeschlagenen, den Verhungerten, und denen, die irrsinnig geworden waren”, von ihrer Begegnung mit Milena im Lager, von einer Freundschaft hinter Stacheldraht, von menschlicher Berührung inmitten der seelenlosen Welt alltäglicher Grausamkeit, von Milenas„von schweren Leiden gezeichnetem Gesicht”, zu ihrer „grauen Gefängnisblässe“, ihren„geschwollenen Händen”, ihrem ständigen Frieren, „das sich auch nachts unter den dünnen Decken nicht erwärmen konnte.”
Und schließlich sehe ich den ersten Stern leuchten, da ich lese, wie Milena „beim Arbeitsappell über die Lagerstraße marschierte, ich stand am Rande, um ihr zuzunicken. sie erblickte mich, riss das vorschriftsmäßige Kopftuch herunter und winkte über die Köpfe der erstarrten Häftlinge und der verblüfften SS lachend mit dem weißen Tuch.”
Und ich sehe den Tierkreis erstrahlen, als sie „wagten, einander unterzufassen, denn das war in Ravensbrück streng verboten. Wir gingen im Dunkeln auf der Lagerstraße Hand in Hand.”
Und da Margarete auf der Krankenstation des Lagers am Bett ihrer Freundin Milena steht, da sehe ich sogar die Moleküle in der Atmosphäre leuchten: „Die Sterbende liegt in Euphorie. Ihr Gesicht strahlt, die Augen glänzend und dunkelblau, und als ich zu ihr trete, breitet sie die Arme aus, begrüßt mich mit dieser wunderschönen, ihr eigenen Geste. Sie kann nicht mehr sprechen.”
Ich blättere zurück zum Impressum. München, 1963, Wie ist das Buch nach Bangkok gekommen? Und wie hat es Jerome gefunden? Ich habe es mir gleich aus seinem Haufen gefischt, Milena wegen. Genauer gesagt, Milenas Kafka wegen. Der war nämlich ziemlich präsent in Mamas Bücherregal. Ich war damals ja so verloren in meinem inneren Dunkel, dass ich begann, mich mit derselben Akribie an Mamas Büchern abzuarbeiten, mit der ich die Splitter unter der alten Eiche aufgesammelt hatte. Nur Grass ließ ich fortan links liegen, seine Bücher stellte ich alle außer Sichtweite ins unterste Regal. Im mittigen Regal direkt auf Augenhöhe ordnete ich meine Lieblingsbücher ein, und zwar farblich, von hell nach dunkel. Verständlicherweise war ich damals schwer beeindruckt von Hesses Demian und erstellte eine Liste der „Träger des Kainszeichens“.
Bücher, die ich Abel zuordnete, stellte ich zu Grass in die Reihe. Manche meiner Kain-Bücher las ich zehnmal, bestimmte Passagen daraus sogar hundertmal, so dass ich sie bis heute auswendig weiß. Nie vergessen werde ich zum Beispiel, wie Kafka Milena die Liebe erklärt: „Hat man nicht die Augen, um sich sie auszureißen und das Herz zum gleichen Zweck? Dabei ist es ja nicht so schlimm, das ist Übertreibung und Lüge, alles ist Übertreibung, nur die Sehnsucht ist wahr, die kann man nicht übertreiben. Aber selbst die Wahrheit der Sehnsucht ist nicht so sehr ihre Wahrheit, als vielmehr der Ausdruck der Lüge alles übrigen sonst. Es klingt verdreht, aber es ist so. Auch ist es vielleicht nicht eigentlich Liebe wenn ich sage, daß Du mir das Liebste bist; Liebe ist, daß Du mir das Messer bist, mit dem ich in mir wühle… ”
Nie wieder vergessen habe ich auch die Worte, die Iwan zu seinem Bruder Aljoscha spricht, damals weinte ich immer, wenn ich sie las, weil ich sie so sehr liebte: „Begreifst du, was das ist, wenn ein kleines Wesen, das sich noch nicht Rechenschaft davon geben kann, was ihm geschieht, sich mit den winzigen Fäustchen an die zerschundene Brust schlägt und in Kälte und Dunkelheit, unter blutigen, arglosen, sanften Tränchen zu seinem ‚lieben Gott’ ruft, er möge es schützen – begreifst du diesen Widersinn, mein Freund und mein Bruder, mein sanftmütiges Mönchlein, begreifst du, was dieser ganze Widersinn soll und wozu er geschaffen ist? Die ganze Welt der Erkenntnis ist diese Kindertränchen vor dem ‚lieben Gott’ nicht wert.“
Oder wie ich jedesmal lachte, wenn ich an der Dorfkirche vorbeifuhr, weil ich Philip Roth im Ohr hatte: „Seine Vorstellung von Gott war die eines allmächtigen Wesens, das nicht aus drei Personen in einer Gottheit bestand, wie im Christentum, sondern aus zwei – einem kranken Wichser und einem bösen Genie.“ Nicht, dass ich nur noch mit Mamas