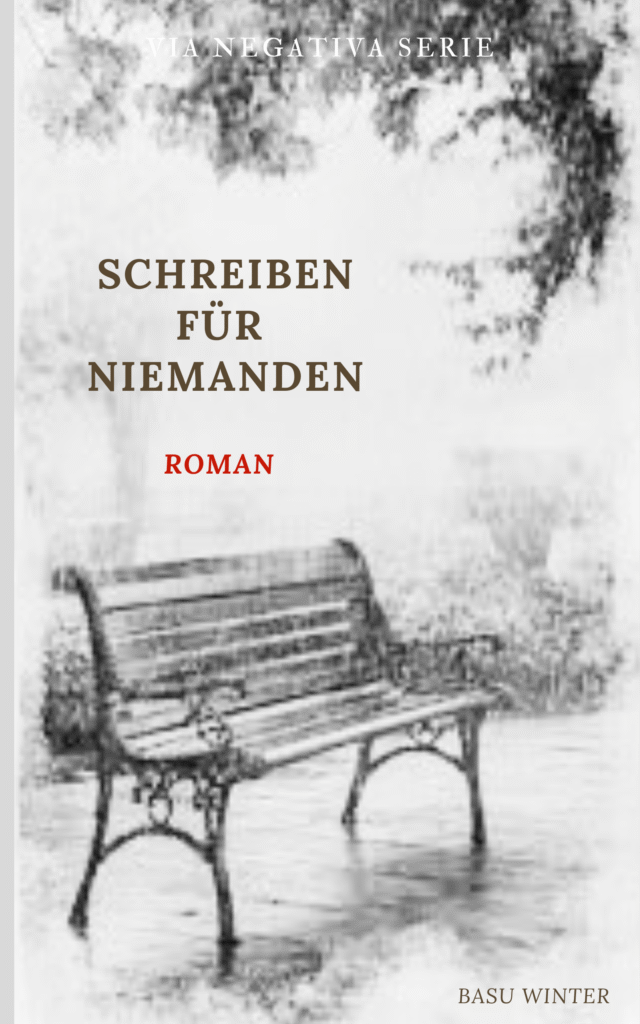
Schreiben für niemanden, Roman
348 Seiten
Finn schreibt Briefe an seinen Sohn, der nicht mehr mit ihm spricht. Aber nicht aus dieser, sondern aus einer inneren Welt heraus: dem hyperbewussten Raum. Hier existiert die Zeit nicht, hier sind die Toten nicht tot, und der Raum ist grenzenlos. Jedes Wort nimmt hier Gestalt an, jede Form enthüllt ihre Essenz. Dostojewski, Kafka, Bukowski, Mozart, Nietzsche, sie sind alle hier — als unendliche Spieler des unendlichen Spiels.
Blick ins Buch
“Warum ich Alkoholiker bin und bleiben will.“
“Gefällt mir“, meint Roth.
“Zu lang“, meint Coetzee.
Finn schreibt den Arbeitstitel trotzdem auf die Frontseiten der Hefter.
“Da ist er ja endlich!”
Coetzee geht zu dem blauen Wagen und reicht den Karton durch das offene Beifahrerfenster. “Hier, müssten fünf oder sechs Kopien sein.”
Sein Literaturagent nimmt den Hefter entgegen und versichert auf Coetzees eindringliche Mahnung hin noch einmal, das Manuskript nicht nur baldmöglichst zu lesen, sondern auch wie versprochen an ein gutes Dutzend Kollegen und Verlage zu schicken, und zwar noch heute. Dann winkt er zum Abschied aus dem Fenster und braust davon.
“Keine Sorge”, sagt Coetzee, als er zurückkommt und die leichte Sorge sieht, die Finn ins Gesicht geschrieben steht, “noch kannst du ja die Reißleine ziehen. Ist der Vertrag einmal unterschrieben, dann ist es allerdings zu spät, dann nimmt die Sache von ganz allein ihren Lauf. Wie, wenn du deine Scheidungspapiere unterzeichnet hast. Hier muss zwar kein Richter ran, aber dafür Lektoren, für inhaltliche Änderungen des Manuskripts musst du offen sein. Es können auch mal ganze Kapitel wegfallen. Ganze Figuren. Ganze reflektive Passagen, die dir vielleicht wichtig sind, aber den Lesefluss stören. Der Kunde ist König, und das ist in dem Fall eben der Leser. Die Vermarktbarkeit ist das A und O. Auch rechtliche Fragen werden auftauchen, etwaige Copyright-Verletzungen, das müssen die Juristen klären. Danach geht die Arbeit erst richtig los. Nicht nur das Buch, auch der Autor als Marke braucht ein Gesicht. PR-Beratung, Interviews, Lesereisen, die sozialen Medien bedienen…”
“So eine Scheiße. Machst du das gerne?”
“Nein, aber es gehört zum Geschäft. Ich bin Autor, aber auch Unternehmer. Ich will Erfolg. Ich mag Anerkennung. Ich brauche Geld. Und es ist viel Geld im Spiel.”
Was Roth im Anschluss über seine eigene Scheidung erzählt und dann über die generelle Bevorteilung der Frau in Scheidungsverfahren doziert, das hört Finn nur aus der Ferne. Finn ist anderswo. Die Gespenster sind geweckt. Es spukt in Finns Hirn. Finn hält Lesungen, gibt Interviews, schreibt Widmungen. Er hält sogar eine Dankesrede, bei der du, lieber Michel, im Publikum klatscht. Er bittet dich sogar auf die Bühne. Er nimmt dich unter Beifall in die Arme, ihr lacht. Du bist stolz auf deinen Vater.
Es ist das Gespenst seiner Wiedergeburt in der Welt der Nützlichkeit, das deinen Vater umtreibt. Finn als Gewinner. Eine Stimme, die etwas gilt und mit Geld vergolten wird. Finn, wie er in seinem viel zu großen Haus auf der Terrasse steht und rauchend aufs Meer hinausschaut. Ein alter Schreibtisch unter freiem Himmel, an den er sich schließlich setzt, ein Roman, an dem er dort schreibt, derweil unter ihm die Wellen brechen – ein Mann, der eine alte Eiche fällt, der als gefällter Baumstamm weiterlebt und später als Parkett in seinem eigenen Wohnzimmer liegt, derweil der Geist des Baumes in seinen Menschenkörper einkehrt und sein Leben weiterlebt, nur sieht er alles zum allerersten Mal, auch seine Gattin, die natürlich spürt, dass er mit anderen Augen auf sie schaut und dadurch selbst plötzlich eine ganz andere wird, lebendiger, spontaner, geradezu glücklich.
Ein Segelboot, das im Hafen auf Finn wartet, Törns bis nach Afrika und Asien mit dir als Skipper. Schließlich ziehst du mit auf die Insel. Ihr unternehmt endlose Wanderungen über Vulkanlandschaften und lange Abende im Sternerestaurant am Hafen, Ihr lernt euch neu kennen, Vater und Sohn. Einmal sogar eine Frau dazu, Finns neue Frau, seine erste Frau eigentlich, die erste Frau überhaupt, die er berührt, eine Insulanerin, ein Teil dieser Landschaft, eine Kraft der Natur, von der Welt noch nicht in die Knie gezwungen, noch am Leben als Mensch, Natürlichkeit, die es sonst nicht mehr gibt, Schönheit, die ganz geblieben ist, ein Geschenk des Himmels, Finns Wiedergeburt in der Menschenwelt, Finn zurück im Bild, im Bild einer Familie, die heil ist mit ihm.
Doch wer malt das Bild, da Finn doch verschwunden ist? Ist es das Gespenst seiner selbst, das im Hades sitzt und träumt? Oder träumt das Ganze nun sein Leben?
”Das Gespenst deiner selbst träumt”, meint Carse, der mitliest, “es generiert all unsere Fantasien. Es rekapituliert auch das Leben, wenn der Mensch im Alter oder im Sterben die berühmte Rückschau hält. Es gäbe keine Rückschau ohne das Gespenst deiner selbst. Und auch keine Zukunft, die sich ausmalen ließe. Vielleicht gäbe es noch nicht einmal eine Gegenwart. Kein Selbst. Und auch keine Welt. Hier im hyperbewussten Raum können wir ja auch nur stehen, weil wir auf dem Gespenst stehen. Im Außerhalb des Traums, das zum Innerhalb gehört. Als Auge des Auges, das es ohne das erste Auge gar nicht gäbe.”
“Ich weiß nicht”, meint Roth, “vielleicht ist es ja doch ein hyperbewusster Moment, wenn das eigene Leben noch einmal am Sterbenden vorbeizieht. Wir haben diesen Moment ja eigentlich nur vorgezogen. So dass wir mehr Zeit hatten, Zeit genug, um ganze hyperbewusste Welten zu erforschen und Romane daraus zu basteln. Zeit genug, um die Rückschau zu Ende zu denken. Und damit auch den amerikanischen Traum, den sich Finn gerade ausmalt. Wir wissen ja, was passiert, wenn er den Traum weiterträumt. Dann taucht plötzlich die Großbaustelle neben seinem Haus auf und der Rechtstreit, den er verliert, weil nicht nachzuweisen ist, dass der Makler wusste, dass der Bau des Luxushotels längst geplant und auch genehmigt war. Und der Moment, da die neue Liebe ihm zurecht vorhält, was er tunlichst vergessen hat zu erwähnen, nämlich, dass er eigentlich lieber allein auf der Terrasse sitzt. Und Michels Geständnis, dass er eigentlich gar keinen Bock hat auf die ewigen Wanderungen mit seinem komischen Vater durch leere Landschaften auf der verdammten Insel, sondern die Stadt, normale Menschen, sein altes Leben vermisst. Nicht zu vergessen die Seepiraten, die während eines Landgangs vor der südafrikanischen Küste das Segelboot klauen…”
“Roth spricht aus Erfahrung”, lacht Coetzee.
„Es kann so kommen”, sagt Carse, „muss es aber nicht. Ich würde eher darauf wetten, dass er gar keinen Verlag findet. Meine Bücher waren auch schwer an den Mann zu bringen. Und dann hat sie kein Schwein gelesen.”
“Und das war vor zig Jahrzehnten! Seither ist es nur noch schlimmer geworden”, winkt Roth ab, “die globale Bewegung geht weg vom Hyperbewussten. Frag mal meinen Verleger, wie allein der Buchmarkt eingebrochen ist, wo nicht Horror oder Fantasy draufsteht oder irgendein Weg zu Reichtum und Glück versprochen wird. In ein paar Jahren stehen Bücherwürmer als argwöhnisch betrachtete Sekte da. Ganz zu schweigen von Lesern hyperbewusster Bücher. Da warte ich nur auf irgendwelche Studien, die eine schädliche Wirkung solcher Inhalte auf die menschliche Psyche beweisen. Heute verbrennt man ja keine Bücher mehr. Man manipuliert die Öffentlichkeit, bis diese selber nach Verboten schreit.”
“Die Menschen wollen unterhalten oder informiert werden“ nickt Carse. “Tiefe ist nicht angesagt. Fantastisches zu lesen bringt Kinderspaß. Und Sachbücher sind sicheres, klar definiertes Terrain. Die Kraft des Denkens, die aus der Tiefe kommt, macht den Menschen Angst. Weil sie weder aus der Fantasie noch aus dem Denken kommt. Und auch kein Glaube dabei ist. Wissen entspringt hier dem Nichtwissen. Die Menschen können aber keine Gewissheit akzeptieren, die nicht vom Denken kommt. Oder sie verbieten sich jede Gewissheit, eben weil sie noch etwas glauben wollen.“
“Vor allem dort, wo es bequemer ist und angenehmer“, meint Roth.“
„Man darf nicht vergessen“, fährt Carse fort, “das Spiel besteht ja gerade darin, dass das Gespenst dir verbietet, ganz zu sein. Was heißt verbieten – es sorgt dafür, dass du dir keine Gewissheit erlaubst, die nicht auf dem Verstand beruht. Dass du, selbst wo du einmal als Ganzes das Ganze siehst, die Schau automatisch als irgendeine Art von mystischer Erfahrung abtust oder intellektuell verklärst und damit beendest.“
“Alle Erklärung verklärt“, meint Jed McKenna. “Der menschliche Verstand ist ein Spielzeug im Kinderzimmer der unendlichen Intelligenz. Der arthurische Ritter, der den heiligen Gral sucht, findet immer nur Maya, die Göttin der Täuschung. Der heilige Gral, der goldene Lotus, der Brunnen des Lebens, Blume und Blüte, Baum und Frucht, das alles sind bloß Symbole der Vagina, des Shakti, des Weiblichen, des dunklen Labyrinths. Symbole für Maya sind es, für Lila.“
Julian Jaynes steht auf, nickt, schüttelt den Kopf, nickt. “Was wir in den letzten vier Jahrtausenden durchgemacht haben“, sagt er schließlich, “ist die langsame, unaufhaltsame Entweihung unserer Spezies. Und dieser Prozess wird offenbar bald abgeschlossen sein. Es ist die große menschliche Ironie unseres edelsten und größten Unterfangens auf diesem Planeten, dass wir bei der Suche nach Autorisierung, bei unserer Interpretation der Sprache Gottes in der Natur, dort so deutlich erkennen, dass wir uns so geirrt haben. Es gibt keine äußeren Kräfte in unserer geschlossenen Welt der Energietransformationen. In den Sternen gibt es keinen Platz für einen Gott und keinen Spalt in diesem geschlossenen Universum der Materie, durch den irgendein göttlicher Einfluss dringen könnte, gar keinen.“
“Wenn du dich da mal nicht täuschst“, lacht McKenna. “Es ist schon auffällig, wie bereitwillig ihr alle das Handtuch geworfen habt. Allein wie Dostojewski sich für jede wahre Erkenntnis sofort tausendmal entschuldigte und reumütig zurück in den Raum des Zweifels marschierte. Oder wie Kafka seine Stärke als Schwäche und sein Heilsein als Krankheit abtat. Oder wie Roth und Coetzee ihre spirituelle Autorität verstecken und verbergen müssen. Nicht nur in ihren Büchern, sondern vor allem vor sich selbst.“
“Ich war schon absichtlich blind”, nickt Dostojewski, “das gebe ich zu. Ich wollte früher ja sogar glauben, im Osten sei die Sonne aufgegangen, und es beginne von Osten her ein neuer Tag für die Menschheit. Wenn diese Sonne ganz aufgegangen sei, so wollte ich hoffen, würde man endlich verstehen, was die echten Interessen der Zivilisation seien. Aber es war natürlich alles Quatsch. Mein Wunsch zu glauben war es. Den ich als Stimme der Zivilisation von mir gab.“
“Deren Hauptinteresse darin besteht, dass ihre Welt nicht auf den Kopf gestellt wird, weil plötzlich der Vorhang fällt“, meint McKenna. “Weil dann nämlich ans Licht käme, dass die Sonne nicht im Osten und auch nicht im Westen aufgeht, sondern dass sie nirgends aufgeht, weil da gar keine Welt ist, in der sie aufgehen könnte. So wenig, wie da ein Mensch ist, dem sie scheinen würde. Die einzige Sonne, die auf- und wieder untergeht, bist du selbst. Und zwar in jedem Augenblick. Und damit bist du auch die einzige Autorität, die es geben kann. Zivilisation, das ist nur Mayas Theater. Aber was heißt hier nur Mayas Theater? Es ist doch ziemlich beeindruckendes Theater, das die Göttin der Täuschung hier darbietet! Also genießt die Show, kann ich da nur sagen!“
“Leicht ist das nicht“, sagt Carse. “Es ist schließlich eine ganz neue Art von Leben. Und Stoff für eine ganz neue Art von Kunst. Stoff, wie man ihn überhaupt noch nicht findet, wenn man einmal von deinen paar Büchern absieht.“
„Deine musst du auch dazurechnen“, erwidert McKenna. “Und ganz so leer ist das betreffende Regal nun auch wieder nicht. Und wenn es auch überquellen würde, anrühren würde es trotzdem so gut wie niemand. Das Kali Yuga ist eben das dunkelste Zeitalter. Genießt die Show, es bleibt nichts anderes übrig. Die Maschinenmenschen aufzuwecken kannst du vergessen. Einstweilen geht’s weiter steil bergab. “
“Schwer zu akzeptieren“, findet Finn. “dass die Entweihung da draußen einfach fröhlich weitergeht. Überhaupt ist das Mitmenschliche eine riesige Herausforderung geworden. Der Bäcker, bei dem man am Morgen die Brötchen kauft, kommt auf der Reise jetzt ja gar nicht mehr als Mitspieler in Frage, die Wahrheit interessiert ihn schließlich nach wie vor nicht die Bohne. Familie, Freunde, wer auch immer – es kann und will niemand wissen um die neuen Horizonte, die sich nach der Apokalypse des Bewusstseins auftun. Es ist wie mit der Glocke im Kloster der Heiligen Dreifaltigkeit in Sergeyev, von der Coetzee schreibt.“
“Warst du in Sergeyev, Coetzee?“, fragt Dostojewski. “Ja.“
“Und was hat es mit der Glocke auf sich?“
“Die alte Glocke ist, obwohl sie einen großen Riss aufweist – ein Schaden, der nicht mehr zu beheben ist – nie ausgetauscht und eingegossen worden, sondern erklingt noch heute jeden Tag über der Stadt. Von den Menschen wird sie liebevoll ‘Das hölzerne Bein des heiligen Sergius‘ genannt.“
“Ein solches hölzernes Bein ist auch der hyperbewusste Mensch“, sagt Finn. “Ein solcher Riss geht auch durch uns selbst. Deshalb sind wir hier. Nur Coetzee hört, dass die Glocke durch den Riss heiler klingt. Für die Bewohner der Stadt ist und bleibt der Riss ein Schaden. Ein hölzernes Bein und nicht der Weckruf in ein neues Leben. Das ist der Preis der Reise. Hyperbewusstsein ist gern gesehener Stoff, wo Dostojewskis Raskolnikow seine Schuld sühnt und Coetzees Lurie seine Schande eingesteht, wo Raskolnikow zum Kreuz zurückkehrt und Lurrie zu Kreuze kriecht. Es ist gern gesehener Stoff, wo es als hölzernes Bein daherkommt, als seltene Krankheit, von der sich der Michel – die Gesellschaft – frei weiß, die es, wenn sie es denn überhaupt bemerkt, fasziniert betrachtet wie das gesunde Mädchen aus gutem Hause den verkrüppelten Bettler am Straßenrand. Dass du heiler klingst, hört niemand. Dass du vom Ganzen her blickst, sieht niemand. Dass dein Leben von der Quelle her fließt, spürt niemand.“
”Das Maul am besten gar nicht erst aufmachen”, empfiehlt McKenna.
”Ein Weiser Rat.”, pflichtet Nisargadatta bei.
Den sie natürlich beide nicht befolgen. Morgens beim Bäcker vielleicht. Aber nicht den ganzen Tag, nicht ein ganzes Leben lang. Und schon gar nicht den eigenen Kindern gegenüber. Wer weiß, ob es wirklich so weiser Rat ist. Das Herz will teilen. Der Geist will spielen. Und es ist ja nicht so, dass man die Pest im Gepäck hätte. Die Gesellschaft hat die Pest. Der verkrüppelte Bettler zeigt ihr ihr wahres Gesicht. Finns Sohn Michel hat die Pest. Sein obdachloser Vater zeigt ihm sein wahres Gesicht. Finn ist der Spiegel seiner Möglichkeit. Nur kann Michel ihn als Möglichkeit nicht nutzen. Denn damit transzendierte er ja seine Wirklichkeit. Die Transzendenz ist aber gar nicht sein Ziel. Im Gegenteil: Er will in der Welt sein. Und wie die Welt um jeden Preis in seiner Wirklichkeit bestehen bleiben. Als Dasein, das seine Risse kaschiert, indem es sie als nutzlos deklariert und wie durch Zauberhand aus dem Sichtfeld manövriert und im Verborgenen deponiert. So lebt der Michel. Und so stirbt er auch. Und so stirbt er aus.
Der Mensch sei ein Übergang oder ein Untergang, sagt Nietzsche. Die Menschheit rottet sich selbst aus, eben weil sie den Übergang verweigert. Wenn Finn die Reise genießen will, dann muss er auch dieser Tatsache ins Auge schauen, und zwar ohne zu blinzeln. Weinen kann er, so viel er will ob des Leids und des Grauens und des bösen Endes der Welt, und bitter sein ob seines verlorenen Hofes, seiner verlorenen Gattin, seines verlorenen Kindes und höhnisch lachen ob des Wahnsinns der Menschen, ob des absurden Theaters auf allen Bühnen menschlicher Welten – aber er darf nicht blinzeln. Er darf keine Sekunde lang vergessen, dass alles hier nur Traum ist, sonst endet der Rundflug im Sturzflug, und Finn muss die Trümmer einsammeln in Platos Höhle.
Im besten Falle lernt er, auch das zu genießen als Teil der Reise. Es macht ja nichts, es bleibt ja beim Blinzeln, es überdauert nicht den Augenblick, es entsteht keine Wirklichkeit daraus in Platos Höhle. So wie sich das Bohren einst verselbstständigte, so verselbstständigt sich auch das Fallen. Und wo immer Finn jetzt noch zurück ins Dasein fällt, da fällt er noch im selben Atemzug wieder aus ihm heraus. Und was aus dem Augenblick herausfällt, das fällt in die Ewigkeit. Fliegen heißt, für die Ewigkeit leben. Als Ewigkeit. Im Daseinskleid.
Leider fliegst du einstweilen ziemlich allein. Denn du stehst ja mit einem Bein noch im Albtraum vom Ernst der Wirklichkeit. Das Spiel vom Ernst, das fast jeder Mensch spielt, hört ja nicht erst auf, wo die Ziellinie erreicht ist. Es hört als Spiel auf, indem es zu einem Ziele hin gespielt wird. Es wird nicht mehr Zeit dem Spiel gewidmet. Sondern das Spiel wird der Zeit gewidmet. Es wird in die Zeit getragen. Und ihr geopfert. Es wird Ernst. Das ist der Albtraum der Menschenwelt.
“Die territoriale Persönlichkeit”, diktiert Carse, “ist das psychologische Pendant zu dieser Art von Lebenstheater. Glaube ist das religiöse Pendant. Das Prinzip der Nutzbarkeit ist das gesellschaftliche Pendant. Der Nenner aber bleibt stets derselbe. Der Nenner ist stets die Täuschung. Und alle Täuschung ist in letzter Instanz Selbsttäuschung. Die Essenz des Ernstes ist die Selbsttäuschung. Was sich in Wahrheit erkennt, das erkennt Dasein als Spiel.”
Finn sieht jetzt das Muster wahrhaftigen Spiels. Es ist vergleichbar mit dem Spiel des Welpen mit der Welt und doch wieder ganz anders. Das Spielfeld des Welpen bleibt auf die unmittelbare Welt begrenzt. Wahrhaftiges Spiel umfasst alle Welten. Einst war sogar das Hyperbewusstsein vom Ernst in Beschlag genommen. Nun ist es nur noch Spielfeld. Damit aber ist das Spielfeld unendlich. Und damit ist es auch das Spiel.
“Es ist doch fantastisch”, meint Coetzee, “dass wir freiwillig hier sind. Als freie Geister im Raum der Nutzlosen. Frei und nutzlos wie der Blick hinaus aufs offene Meer. Frei und nutzlos wie das Auge, das nicht schaut, um in der Ferne irgendwelche Konturen zu erkennen, sondern um als Blick im Horizont zu versinken und damit als Auge zu verschwinden.“
“Neulich war ich meine obdachlosen Kumpels in der Unterführung hinterm Bahnhof besuchen“, erzählt Finn. “Ich wollte eigentlich mindestens eine Woche bleiben, aber irgendwie war der Besuch ziemlich ernüchternd, obwohl wir viel gelacht und gesoffen haben. Ich fühlte mich so leer irgendwie. Als sei ich in einem früheren Leben, aber nicht als ich selbst, sondern als Fremder. Vertraut war das alles bloß aus der Erinnerung. Aber es war nicht meine Erinnerung. Es war der Raum der Erinnerung im Verstand, aus dem heraus ich die Gegenwart betrachtete. Als ich aus dem Raum herausging, verschwand der Filter. Die Gegenwart war neu. Ich sah fremde Menschen sitzen und saufen und Mist labern. Als Kultur, dachte ich mir, blühen die nicht gerade. Ich war schnell wieder weg.”
“Kultur nur in dem Sinne, dass sie das hässliche Gesicht der Gesellschaft spiegeln”, erwidert Carse. “Saufen in die Selbstvergessenheit, nicht in die Tiefe, nicht ins Hyperbewusstsein. Kindlicher Rausch, der die Konsequenzen ignoriert. Das genau ist ja der Hedonist. Und das ist auch der Michel, der abends die Nachrichten schaut und anschließend den Tatort. Was er da konsumiert, das macht etwas mit ihm. Das sieht er aber nicht. Er sieht nicht, dass ihm etwas verkauft wird. Noch sieht er, was er kauft. Und welchen Preis er dafür bezahlt.”
”Und was hat das mit dem Raum der Vergangenheit zu tun?”
“Spiel auf ein Ziel hin wird Ernst. Spiel aus der Vergangenheit heraus wird ebenfalls Ernst. Es ist sogar derselbe Ernst, dasselbe Spiel. Denn wo ist das Ziel denn hergezaubert worden? Aus der Erinnerung natürlich. Spiel bleibt aber nur im Spiel mit der Erinnerung Spiel. Und wo die Vergangenheit in der Schwebe bleibt, da kann ja gar keine klar umrissene Zukunft angestrebt werden. So bleibt Schöpfung Spiel. Das gilt für jeden Raum und jedes Selbst und alle Welten.”
“Unendliches Spiel.”
”Mit immer neuen Horizonten am unendlichen Horizont.”
„Das ist in der Tat geistiges Neuland“, murmelt Coetzee nachdenklich. „Die Historie der Menschheit könnte ernster ja gar nicht sein. Und auch nicht ernster genommen werden. Von der Kulturgeschichte ganz zu schweigen.“
“Alle europäische Literatur entspringt einem Kampf”, nickt Roth. “Und worum haben sie denn gestritten, diese gewalttätigen, mächtigen griechischen Götter? Es ist so banal wie jede Kneipenschlägerei. Sie streiten um eine Frau.”
“Göttlicher Kindergarten”, winkt Coetzee ab. “Wie schon bei den Pharaonen, die ihre Sklaven mit ins Grab genommen haben, auf dass sie sich nicht sorgen mussten, wer in der Nachwelt ihre Füße wäscht. Im Gegenzug wurde den menschlichen Sklaven die Unsterblichkeit versprochen. Soweit man weiß, haben diese den Handel akzeptiert und sich gern vergiften lassen. Heute hat der Michel halt neue Götter. Neue Götter gebären neue Feinde, neue Feinde gebären neue Helden. Unsterblich wird aber immer noch nur der Soldat, der den Feind abschlachtet – oder abgeschlachtet wird auf dem Schlachtfeld namens Welt. Der nicht ganz so rühmliche Michel setzt halt auf seine Kinder. Oder er sitzt im Fußballstadion und singt voller Inbrunst Hymnen auf seinen Verein. Die Triumphe seines Vereins: seine Unsterblichkeit.”
“Man schämt sich, Mensch zu sein”, findet Finn. “Als Gott unter Göttern hat man’s auch nicht besser“, meint Coetzee, “und scheint allenfalls schlauer zu werden mit der Zeit, aber nicht weiser. Achilles, Atreus, Apollon, Zeus, die wären heute CIA-Direktor oder Google-CEO oder der heilige Papst. Vielleicht sind sie es ja. Archimedes kommt als der Idiot Apollon wieder, dann als irgendein scheiß König, und heute ist er Putin oder Trump. Repräsentanzen derselben Grundhaltung- und -perspektive, alle miteinander. Die nichts an Tiefe hinzugewonnen hat. Ein flacher Kreis ohne die Möglichkeit der Transzendenz.“
“Wobei ich die griechischen Götter ja mag“, wirft Roth ein. “Alles, was Zeus jemals tun will, ist ficken – Göttinnen, Frauen, Tiere – und das nicht nur in seiner eigenen Form, sondern viel lieber noch als Tier manifestiert. Zeus ist nicht nur pervers, er ist völlig verrückt. Und total verdorben. Vergleich das mal mit dem hebräischen Gott, unendlich allein, der einzige Gott, den es je gegeben hat und geben wird. Und was macht er den ganzen Tag? Sich um uns Juden sorgen. Oder sieh dir Jesus an! Maria die Unbefleckte ist doch die Mutter aller Schuld und Scham! Weil wir eben nicht rein erschaffen sind. Wir sind nach dem Ebenbild von Zeus erschaffen. Eines völlig verdorbenen Gottes.“
”Ein Teufel doch eher”, findet Kafka.
”Luzifer“, nickt Carse.
”Meinetwegen“, erwidert Roth achselzuckend. ”Aber dann ist der monomanische Gottesvater Satan.“
”So ungefähr sahen es die Gnostiker“, nickt Carse. ”Der Demiurg, der Schöpfer dieser Welt, der Jahwe aus dem Alten Testament, ist aus ihrer Sicht ein bösartiger, ignoranter Gott – der so gar nichts gemein hat mit dem wahren Gott. Demgemäß wären Zeus, Luzifer und die Menschen allesamt gefallene Söhne eines gefallenen Gottes.“
”Das mag gut und gern sein“, sagt Roth, ”also sind wir alle kleine Teufel.“
“Das auf jeden Fall“, wirft Frisch ein. ”Ich muss mir nur mein altes hässliches Gesicht im Spiegel anschauen oder einen Moment in mich horchen, da weiß ich, dass ich mit Sicherheit nichts von einem Engel an mir, geschweige denn in mir habe! Wenn, dann ist der Engel mit Sicherheit ziemlich tief gefallen. Und mit der Fresse zuerst aufgeschlagen.“
”Ich seh mich da auch wieder“, nickt Roth. ”Wahrscheinlich hat Luzifer Eva gebumst. So fing alles an.“
”Gäbe es Luzifer nicht, wären wir jedenfalls alle arbeitslos gewesen”, stimmt Dostojewski ein. „Dann wäre die europäische Literatur bis heute voll von Sonnenstrahlen, die über bunte Blumenwiesen tanzen, und zarten weißen Wölkchen, die am blauen Himmel stehen.“
“Genaugenommen habt ihr es Maya zu verdanken“, bemerkt McKenna.
“Danke, Mama!“, ruft Roth.
Wie jeden letzten Sonntag im Monat geht Finn den Waldweg hinab Richtung Stadt. Der Weg ist lang genug, um im Geiste noch einmal die Bibliothek des Hyperbewusstseins zu durchwandern. Sich ungefähr zurechtzulegen, was er heute zu Papier bringen wird. Nicht nur das, mittlerweile hat Finn auch angefangen, die Briefe in eine Reihenfolge zu bringen, die für den Jungen Sinn ergibt. Und dabei festgestellt, dass er ganz anders anfangen muss als eigentlich geplant. Während er dem schmalen Bachlauf hinab folgt, schreibt Finn im Geiste einen neuen ersten Brief:
Lieber Michel!
Du musst dir die Welt als gigantisches Netzwerk der Täuschung vorstellen, in dem nicht nur alles verbunden ist, sondern auch voneinander abhängig. Alles wirkt aufeinander – und zwar permanent und ausnahmslos. Was mir widerfahren ist, geht dich also mehr an, als du dir je vorstellen könntest. Ob du nun mit mir sprichst oder nicht spielt in diesem Zusammenhang überhaupt keine Rolle! Es ist auch gleich, ob du um mein Schicksal weißt oder nicht – es wird in jedem Falle großen Einfluss auf dich und dein Leben haben! Und da ist es doch besser, darum zu wissen, meinst du nicht?
Nur ist es nicht leicht, es dir zu erklären. Ich will es dennoch versuchen. Dabei werde ich vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen müssen und mit Zeiten und Räumen jonglieren, dass es einem schwindlig werden kann. Es geht aber nicht anders. Um Dinge zu erkennen, muss man ganz nah an sie herantreten, ja bestenfalls in sie eindringen – und sie gleichzeitig aus unendlicher Ferne betrachten. Das kannst du mit allen Dingen tun. Ich habe es mit allem getan. Auch mit mir selbst. Mit überraschendem Ergebnis. Wundere dich also nicht, wenn ich hier von deinem Vater in der dritten Person spreche, wiewohl ich es bin.
Im Park angekommen notiert Finn die zurechtgelegten Sätze. Dann markiert er den Text mit einer eins. An zweite Stelle setzt er die erste Spielregel:
Spielregel 1: Zwei Arten von Spielen
„Es gibt mindestens zwei Arten von Spielen. Eines könnte man endlich nennen, das andere unendlich. Ein endliches Spiel wird gespielt, um zu gewinnen, ein unendliches Spiel, um zu verhindern, dass es endet.“
James P. Carse Finn sitzt immer auf derselben Parkbank unweit der Hundewiese mit Blick aufs Stadion. Oft ist er dermaßen in seine Notizen vertieft, dass er stundenlang nicht aufschaut. Von Warten kann also keine Rede sein. Zumal Finn gar nicht damit rechnet, dass der Junge auftaucht. Seit zwei Jahren und neun Monaten nicht mehr. Solange schreibt Finn schon seine Briefe. Anfangs war Michel gerne gekommen. Das spürt man als Vater. Das erste Wiedersehen bleibt unvergesslich. Michel wartete schon. Die Umarmung war innig von beiden